Prof. Dr. Michael Schnegg
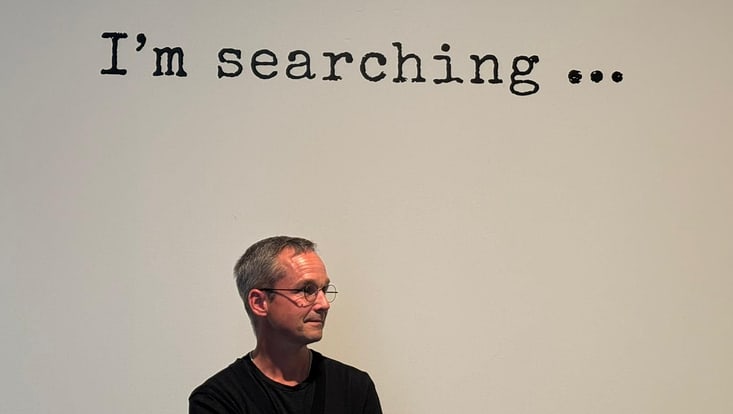
Vita
Prof. Dr. Michael Schnegg ist Ethnologe an der Universität Hamburg. Er hat umfangreiche ethnografische Feldforschung in Mexiko und Namibia durchgeführt. Seine aktuelle Forschung befasst sich mit der Frage, wie es sich anfühlt, in einer zunehmend urbanisierten und sich erwärmenden Welt ein ländliches Leben zu führen. In seinem Arbeiten trägt er zur Entwicklung einer phänomenologischen Anthropologie bei, die Philosoph:innen und Anthropolog:innen zusammenbringt, um gemeinsam an einer empirisch fundierten Theoretisierung drängender Fragen, darunter auch des Klimawandels, zu arbeiten. Zusammen mit Thiemo Breyer (Philosophie, Universität zu Köln) gründete er das Hamburger Symposium für Philosophie und Anthropologie, das zu einem wichtigen Ort für diese Diskussionen geworden ist. Seine oft interdisziplinären Arbeiten wurden in einer Vielzahl von Zeitschriften der Ethnologie, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften, Kommunikationswissenschaft, Geografie und theoretische Physik veröffentlicht.
Publikationen (Auswahl)
- Schnegg, Michael. 2023. "Phenomenological Anthropology: Philosophical Concepts for Ethnographic Use." Zeitschrift für Ethnologie 148 (1): S. 59–102. https://doi.org/https://doi.org/10.60827/zfe/jsca.v148i1.1265.
- Schnegg, Michael. 2025. "Collective Loneliness. Theorizing Emotions as Atmospheres." Current Anthropology 66 (2): S. 206–231. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1086/734796. https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/734796.
- Schnegg, Michael, and Richard Dimba Kiaka. 2018. "Subsidized Elephants: Community-based Resource Governance and Environmental (In)justice in Namibia." Geoforum 93: S. 105–115. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.05.010. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718518301490.
- Schnegg, Michael, and Thiemo Breyer. 2022. "Empathy Beyond the Human. The Social Construction of a Multispecies World." Ethnos 89 (5): S. 8488–69. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00141844.2022.2153153.
- Schnegg, Michael. 2024. "Culture as Response." Ethos 52 (2): S. 308–323. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/etho.12427. https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/etho.12427.
Forschungsvorhaben: Climate Hope
In den letzten Jahren haben negative Klimaemotionen wie Angst, Furcht und Verzweiflung die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit gleichermaßen auf sich gezogen. Diese Emotionen haben maßgeblich zur Mobilisierung beigetragen, führen aber zunehmend auch zu psychischen Problemen, sozialen Spannungen und politischer Lähmung. Vor diesem Hintergrund werden Forderungen nach mehr Hoffnung angesichts der Klimakrise laut. Das Argument lautet, dass eine Gesellschaft nicht ohne erhebliche psychologische und soziale Kosten in einem Zustand der Panik verharren kann und dass Hoffnung notwendig ist, um positive Zukunftsvisionen zu entwickeln. Während meine frühere Arbeit (in Zusammenarbeit mit Julian Sommerschuh) die Bedingungen untersucht haben, unter denen Klimahoffnung entstehen kann, insbesondere im Globalen Süden, zielt dieses Projekt darauf ab, die Auswirkungen von Klimahoffnung aufzuzeigen. Dazu stütze ich mich auf phänomenologische Konzeptualisierungen von Hoffnung (Gabriel Marcel) und verwandte Konzepte, insbesondere den Begriff der Natalität, der in Hannah Arendts Werk zu finden ist. Darüber hinaus werde ich mich mit indigenen Theoretisierungen von Hoffnung befassen, oder allgemeiner gesagt, mit positiven Erwartungen, um Phasen der Ohnmacht und Verzweiflung zu überwinden. Vorläufige ethnographischen Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Vorstellungen stark verkörpert sind und auf die Körperteile hinweisen, in denen Hoffnung wachsen kann (wie die Lunge oder das Herz) und wir so zn hoffnungsvollere Menschen werden.
